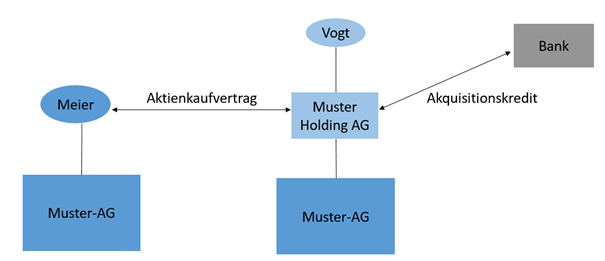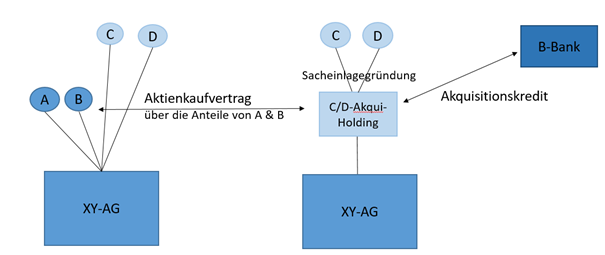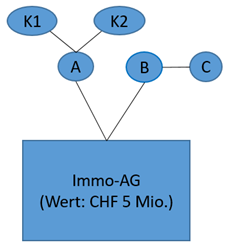NEUE MÖGLICHKEITEN BEI DER DURCHFÜHRUNG VON GENERALVERSAMMLUNGEN

lic. iur. Patricia Geissmann, Rechtsanwältin

Am 19. Juni 2020 verabschiedete das Parlament die dritte grosse Aktienrechtsrevision in der Geschichte des vereinheitlichten Gesellschaftsrechts. Eine entscheidende Modernisierung erfahren insb. die Vorschriften zur Durchführung der Generalversammlung. Die neuen Bestimmungen werden voraussichtlich per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Aufgrund des Änderungsbedarfs der Statuten, welcher wie immer geplant sein will, soll indes bereits heute auf die neuen Möglichkeiten im Bereich der Abhaltung der Generalversammlung hingewiesen werden.
.
I. EINLEITUNG
Die Aktienrechtsrevision 2020 beinhaltet eine weitgehende Überarbeitung in den Bereichen Corporate Governance, Aktionärsrechte, Generalversammlung, Aktienkapital, aktienrechtlicher Klagen, in der Geschlechtervertretung im Verwaltungsrat sowie im Sanierungsrecht. Im Bereich der Durchführung von Generalversammlungen soll einerseits den Gesellschaften mehr Flexibilität eingeräumt werden, andererseits sollen aber auch die Teilnahmerechte der Aktionäre gestärkt werden. Nachfolgend werden die gewichtigsten Änderungen auszugsweise vorgestellt.
:
II. WESENTICHE NEUERUNGEN (AUSZUG)
a) Elektronische Einberufung der Generalversammlung
Art. 696 OR ermöglicht bereits heute die elektronische Einberufung der Generalversammlung, solange die Statuten diese Möglichkeit vorsehen. Der Geschäfts- bzw. Revisionsbericht muss indes nach geltendem Recht auch bei einer elektronischen Einberufung physisch am Sitz der Gesellschaft aufgelegt sein. Auf dieses Erfordernis wird unter dem revidierten Recht verzichtet. Geschäfts- und Revisionsbericht müssen den Aktionären lediglich zugänglich gemacht werden. Neu können diese Unterlagen also auch elektronisch zur Verfügung gestellt werden.
Inhaltlich muss sich die elektronische Einberufung der Generalversammlung neu auch dazu äussern, ob die Versammlung physisch oder gegebenenfalls auch virtuell stattfindet, denn diese Möglichkeiten bietet die Aktienrechtsrevision. Und es ist in der Einladung auch anzugeben, ob – im Fall einer nach wie vor physisch stattzufindenden Versammlung – diese an einem oder an mehreren Orten erfolgt.
Wie erwähnt, muss die Möglichkeit der elektronischen Einberufung der Generalversammlung in den Statuten verankert sein. Fehlt diese, sind die in der Versammlung getroffenen Beschlüsse anfechtbar.
:
b) Tagungsort(e) der Generalversammlung
Entgegen dem geschriebenen geltenden Recht kann eine Generalversammlung nach revidiertem Aktienrecht nicht nur an einem Ort, sondern nun offiziell auch an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Die Lehre lässt dies bereits unter geltendem Recht zu, sofern sachliche Gründe vorliegen. Die Aktienrechtsrevision schafft insofern ein Stück mehr Rechtssicherheit, indem diese Möglichkeit nun auch gesetzlich verankert wird und auf das Vorliegen sachlicher Gründe verzichtet. Möglich ist neu auch, dass der Tagungsort (auch ohne sachliche Gründe) ins Ausland verlegt werden kann. Dabei gilt es indes nach wie vor zu beachten, dass die Ausübung der Aktionärsrechte – wenn auch nur jene einer Minderheit – dadurch nicht in unsachlicher Weise erschwert werden darf. Das Gleichbehandlungs- und Sachlichkeitsgebot gilt nach wie vor und ist zu wahren.
Einen erweiterten Spielraum gewährt das neue Gesetz, indem bei eingeschränkter Erreichbarkeit eines Tagungsortes für einzelne Aktionäre eine virtuelle Teilnahmemöglichkeit geschaffen werden kann oder denjenigen Aktionären, denen eine Teilnahme nicht oder nur unter erschwerten Voraussetzungen möglich ist, ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Seite gestellt wird. Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen hätte – wie auch schon bis anhin – die Anfechtbarkeit sämtlicher in einer solchen Versammlung gefasster Beschlüsse zur Folge.
Soll die Generalversammlung im Ausland stattfinden, haben die Statuten hierfür die Grundlage zu schaffen. Diese erfordert eine qualifizierte Mehrheit, d.h. 2/3 der Aktienstimmen und die Mehrheit der Aktiennennwerte. Weiter hat der Verwaltungsrat einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bezeichnen, welcher auf Wunsch hin die Stimmen der nicht anwesenden Aktionäre ausübt.
Bei der Durchführung einer Generalversammlung im Ausland gilt es weiter zu beachten, dass Beschlüsse, die der öffentlichen Beurkundung unterliegen, nicht von einem Schweizer Notar beurkundet werden können. Diesbezüglich ist die Gesetzgebung am Tagungsort zu beachten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass bei Abhaltung der Generalversammlung im Ausland gegebenenfalls ein ausländischer Gerichtsstand für Anfechtungsklagen geschaffen wird. Soweit sowohl ein ausländischer, als auch ein inländischer Tagungsort gewählt wird, steht der Beurkundung der Beschlüsse durch einen am Tagungsort in der Schweiz (in seinem Hoheitskanton) anwesenden Notar nichts im Weg.
Für die Durchführung einer Generalversammlung an mehreren Tagungsorten (sofern nicht im Ausland) bedarf es keiner besonderen Statutenbestimmung. Es muss indes sichergestellt sein, dass die Versammlungen alle gleichzeitig durchgeführt werden und es müssen sämtliche Voten von allen Teilnehmern unmittelbar in Bild und Ton übertragen werden können. Bedürfen solche Generalversammlungsbeschlüsse der öffentlichen Beurkundung, reicht es aus, wenn sich der beurkundende Notar an einem der diversen physischen Tagungsorte befindet und von dort aus die Beschlüsse, die über virtuelle Übertragung auch an anderen Tagungsorten gefasst werden, beurkundet.
;
c) Physische vs. virtuelle Durchführung der Generalversammlung
Neu ist es möglich, dass Aktionäre ihre Stimme an der Generalversammlung elektronisch ausüben (sog. «direct voting»). Bisher existierte lediglich die Möglichkeit, Instruktionen zuhanden eines Stimmrechtsvertreters elektronisch zu erteilen. Die Aktienrechtsrevision weitet die Aktionärsrechte diesbezüglich also aus. Eine statutarische Grundlage ist für die elektronische Stimmabgabe nicht erforderlich; die diesbezügliche Entscheidungskompetenz liegt beim Verwaltungsrat, wobei er die Sicherheitsvorschriften gem. Art. 701e Abs. 2 revOR zu wahren hat. Diese Bestimmungen beinhalten, kurz zusammengefasst, dass (i) die Identität der Aktionäre in jedem Fall feststellbar ist. Diesbezüglich geht das Spektrum von der Vorweisung einer Identitätskarte bis hin zur Anwendung einer Gesichtserkennungssoftware. Weiter ist an der virtuellen Generalversammlung sicherzustellen, dass (ii) eine unmittelbare Übertragung der Voten erfolgt (sog. Unmittelbarkeitsprinzip), (iii) jeder Aktionär aktiv teilnehmen und auch Anträge stellen kann, und (iv) das virtuell getroffene Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann. Diese Voraussetzungen zeigen, dass es also auch möglich sein wird, eine Generalversammlung ohne Bildübertragung, d.h. bspw. Lediglich per Telefon, durchzuführen.
Soll nicht nur die Stimmabgabe virtuell erfolgen, sondern die Generalversammlung als solche virtuell durchgeführt werden, ist eine statutarische Grundlage erforderlich. Kommt diese mit einer Mehrheit zustande, können sich einzelne Aktionäre somit nicht gegen eine virtuelle Durchführung der Generalversammlung wehren. Der Verwaltungsrat hat lediglich vorzusehen, dass die technischen Anforderungen die Teilnahme auch einem durchschnittlich begabten und mit technischen Hilfsmitteln ausgerüsteten Aktionär ermöglichen.
Das Rede- und Fragerecht an der virtuellen Generalversammlung ist selbstverständlich zu wahren. Somit muss eine unmittelbare Kommunikation in jedem Fall gewährleistet sein. Eine Durchführung per E-Mail ist nicht möglich, da diese das Unmittelbarkeitsprinzip nicht wahrt. Das gleiche Problem stellt sich bei der Übermittlung von Audiodateien. Bei kleineren Generalversammlungen ist daher zu überlegen, ob nicht eine Telefonkonferenz das einfachste, und den gesetzlichen Anforderungen grundsätzlich genügende, Mittel darstellt. Dies selbstverständlich vorausgesetzt, eine Identifizierung kann stattfinden, was aber insb. bei kleineren Gesellschaften meist der Fall sein wird.
Kommt es bei der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung zu nicht behebbaren technischen Problemen, muss die Versammlung zumindest teilw. wiederholt werden. Denn unter technischen Problemen gefasste Beschlüsse sind ungültig. Hiervon zu unterscheiden sind Schwierigkeiten, die im Verantwortungsbereich der Aktionäre liegen. Diese machen die Beschlussfassung nicht ungültig. Zumindest dann nicht, wenn sie nicht flächendeckend und einen Grossteil der Aktionäre betreffen, wie bspw. bei einem Stromausfall oder einem breitflächigen Ausfall / Unterbruchs des Internets. Die Abgrenzung zwischen Problemen im Verantwortungsbereich der Gesellschaft bzw. eben der Aktionäre dürfte im Einzelfall schwierig sein und die Gesellschaften vor neue Herausforderungen stellen.
Müssen Beschlüsse in einer virtuellen Generalversammlung beurkundet werden, stellt sich die Frage, ob bezüglich des Hoheitsgebiets des betreffenden Notars besondere Regelungen gelten. Aktuell wird indes überwiegend die Meinung vertreten, die virtuelle Teilnahme auch des Notars sei unbegrenzt möglich, solange er sich physisch in seinem Hoheitsgebiet befindet und von dort aus die Beurkundung der virtuell gefassten Beschlüsse vornimmt.
:
III. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, wird den Aktiengesellschaften nach revidiertem Aktienrecht ein breites Spektrum an neuen Möglichkeiten zur Seite gestellt, insb. wenn es darum geht, die Generalversammlung zu organisieren und durchzuführen. Dass Erneuerungen in diesem Bereich längst fällig sind, haben nicht zuletzt auch die vergangenen Monate gezeigt, in denen die Pandemie grössere Personenversammlungen verunmöglichte. Wie immer schaffen neue Möglichkeiten aber auch neue Herausforderungen, insb. im technischen Bereich. Zu begrüssen ist, dass der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der neuen Regelungen auch kleinere Aktiengesellschaften im Fokus hatte, weshalb insb. für Gesellschaften mit kleinem Aktionärskreis mehr Flexibilität geschaffen wurde.
15. Februar 2021 / lic. iur. Patricia Geissmann